Ein Gespräch mit Prof. Dr. med. Jalid Sehouli
Die Übermittlung von schlechten Nachrichten ist eine der schwersten Aufgaben, nicht nur im klinischen Alltag eines Arztes, sondern in nahezu allen Berufen und Bereichen unseres Lebens. Lässt sich das Überbringen von schlechten Diagnosen überhaupt erlernen, so wie man Operieren erlernen kann? Hängt es nicht von der individuellen Empathiefähigkeit des Arztes ab?
Wer wüsste das besser als Prof. Dr. med. Jalid Sehouli. Er zählt als Leiter der gynäkologischen Klinik der Charité zum Kreis der weltweit führenden Krebsspezialisten und hat im Laufe seines Berufslebens etwa 200.000 Gespräche mit Patienten und Angehörigen zu führen.
Der Chefarzt ist überzeugt, dass für Patienten mit lebensbedrohlicher Krankheit die offene und empathische ärztliche Kommunikation eine der wichtigsten Hilfen in der Auseinandersetzung mit der Krankheit ist. In seinem Buch „Von der Kunst, schlechte Nachrichten gut zu übermitteln“ verbindet er hilfreiche Ratschläge für die Besprechung existenzieller Situationen mit Geschichten aus seiner ärztlichen Praxis.
Ein Chirurg, der über „Sprache als Medikament“ schreibt. Außergewöhnlich! Der Arzt mit marokkanischen Wurzeln plädiert im Gespräch mit Angelika Beyreuther* für eine Medizin, in der Gefühle und Beziehungen eine große Rolle spielen.
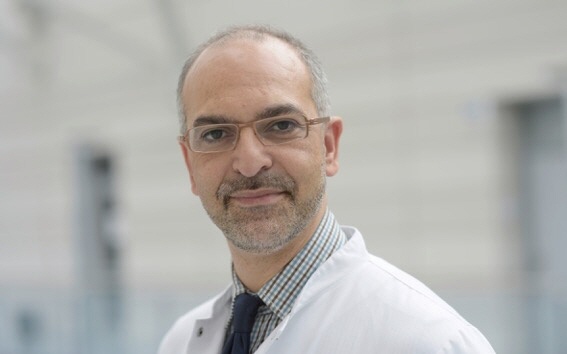
In den Diskussionsrunden zu Ihrem Buch bei der Leipziger Buchmesse überraschten Sie mit der Aussage, dass die Sprache das wichtigste diagnostische und therapeutische Instrument des Arztes ist. Ein Chirurg, der über Sprache als Medikament spricht! Ist es Ärzten heute denn überhaupt bewusst, wie wichtig die Kunst guter Kommunikation ist?
Die Gesellschaft ist sich dessen nicht bewusst. Und die Mediziner – im Sinn eines Spiegelbildes der Gesellschaft – sind sich dieses Themas ebenfalls nicht bewusst. Kommunikation wird immer als gegeben und selbstverständlich betrachtet. Gespräche, die länger als 10 Minuten dauern, können sie einmal im Quartal in der ambulanten Versorgung abrechnen. Die Medizin definiert sich in der Kostenerstattung über Intervention, wie Operationen, und tut sich grundsätzlich immer schwer mit Themen, die sie nicht formal festhalten und messen kann.
Keine Frage, die Sprache ist die wichtigste Arznei des Arztes, aber wie bei anderen Arzneien müssen sie natürlich zunächst definieren und sich klarmachen, wofür diese Arznei gedacht ist. Geht es um den Aufbau einer Bindung, geht es um ein diagnostisches oder geht es um ein therapeutisches Mittel. Sowohl im Studium als auch im klinischen Alltag gibt es dafür bisher keine richtige Plattform, diese Arznei im Sinne der Indikation, der Dosis, der Absicht und auch der inhaltlichen Evaluation zu sezieren.
Man mogelt sich einfach vorbei! Man geht davon aus, dass jeder Mensch irgendwie reden und zuhören kann und man geht davon aus, dass es irgendwie reicht, was man so mitbekommt und was unsystematisch gelehrt wird.
Dieses „Sich-vorbei-mogeln“ ist angesichts der rund 200.000 Gespräche, die ein Arzt in seinem Berufsleben mit Patienten führt, aber doch unbefriedigend; gleichermaßen für Arzt und Patient. Für fast alles im Berufsalltag gibt es Checklisten und Weiterbildungsangebote mit Zertifikaten der Ärztekammern. Wie ein Arzt seine Gespräche zu führen hat oder wie er sie führen kann, dafür gibt es jedoch nur sehr wenige Fort- und Weiterbildungsangebote.
Grundsätzlich gilt: es gibt Fortbildungsempfehlungen und keine Pflicht. Und es dominieren andere Themen. Ein Arzt muss viel wissen. Man ist vor 20 Jahren davon ausgegangen, dass ein Allgemeinmediziner etwa 18 Artikel pro Tag lesen muss, um up-to-date zu sein, so wird David Sackett, einer der Väter der Evidenzbasierten Medizin, immer wieder zitiert. Wissen steigt exponentiell. In allen Berufen steigen die Anforderungen, die Dosisverdichtung, die Arbeitsverdichtung, vom Bäcker bis zum Arzt, überall. Sie haben also einen Konflikt von Zeit und Anspruch. Das bedeutet, dass sie sich natürlich fortbilden, aber die Priorisierung machen sie Themen- oder prozessabhängig. Wenn es ein neues Medikament gibt, dann wollen sie wissen, wie es funktioniert.
Die Sprache ist die vergessene wichtigste Arznei. Es ist dem Arzt gar nicht mehr bewusst, dass Sprache wichtig ist und dass er das verbessern kann und sollte. Also bildet er sich zwar in vielen Themen fort, aber Kommunikation kommt in der Prioritätssetzung ganz weit unten. Im September veranstalten wir hier in Berlin an der Charité eine Masterclass über Krebstherapien. An einem Tag geht es da konkret um Kommunikation. Gestern habe ich bereits eine Liste gemacht, wer aus meinem Team daran teilnehmen muss, denn freiwillig kommt keiner zu diesem Thema. Zusammen mit meiner Kollegin Dr. Christine Klapp biete ich bereits seit 20 Jahren Intensivseminare für Ärztinnen und Ärzte an zum Thema Breaking Bad News. Dabei stellen wir immer wieder fest, dass viele der Teilnehmenden es als echten Luxus betrachten, sich Zeit für die Reflexion ihrer Kommunikationsgewohnheiten zu nehmen.

Das Thema Kommunikation klingt für einen Arzt ja auch erst mal nicht sehr attraktiv und spannend...
...weil die Reflexion darüber, wie gut oder schlecht er selbst kommuniziert, nicht ausgeprägt ist. Er kennt die Pralinenschachtel und er kennt die Beschwerde vom ärztlichen Direktor. Aber er kennt nichts dazwischen. Und der Arzt kann den Patienten auch nicht fragen: War ich gut im Gespräch? Er traut sich das auch nicht zu fragen. Er könnte das fragen! Aber er traut sich nicht. Und ob der Patient tatsächlich dazu auch etwas sagen würde, das ist auch eine andere Geschichte.
Wir brauchen einen grundsätzlichen gesellschaftspolitischen Perspektivwechsel. Wir müssen uns als Gesellschaft – und als Ärzte – die Frage stellen, ob uns Kommunikation und Beziehungen wichtig sind. Dann können wir das ändern. Dann muss dieser Erkenntnis eine Struktur folgen. Es gibt bisher keine Struktur. Es gibt Insellösungen, da mal einen Kurs und da mal einen Kurs, aber das ist zufällig, unstrukturiert, nicht nachhaltig. Wir brauchen strukturelle Rahmenbedingungen, strukturierte Fortbildungen, die man nicht selber bezahlen muss, Fortbildungen, die nicht nur an Wochenenden angeboten werden. Und Gespräche müssen honoriert werden. Es kann nicht sein, dass es für ein CT 700/800 Euro gibt und für ein Arzt-Patienten-Gespräch über existentielle Fragen 21 Euro.
Da müssen wir aber einen großen gesellschaftspolitischen Dialog führen zu Prioritäten in unserem Gesundheitssystem.
Ja, natürlich, wir zahlen in diesem Gesundheitssystem lieber einen Herzschrittmacher als ein gutes Gespräch. Ich bin Chirurg, aber die Chirurgie ist nur ein Teil der Geschichte. Meine Chirurgie ist wichtig, aber auch Kommunikation ist elementar. Ich bin für mich bereit, diesen Dialog zu führen.
Ärzte klagen über Zeitmangel. Gibt es überhaupt genügend Zeit im Arztalltag für eine achtsame Arzt-Patienten-Kommunikation?
Ja, die Zeit ist da! Das ist eine Frage der Priorität. Lesen sie über Ärzte vor tausend Jahren, die beklagten sich auch schon über Zeitknappheit. Wir machen uns das zu leicht. Ich habe extrem wenig Zeit. Aber fragen sie eine berufstätige Mutter oder einen berufstätigen Vater, ob diese denn überhaupt Zeit für ihre Kinder haben. Können Piloten, Polizisten oder Ärzte überhaupt gute Eltern sein? Ja! Es gibt zwar Zeitlimitationen, aber darum geht es nicht, es geht um die Achtsamkeit, um die Wahrnehmung und natürlich um die Umsetzung. Wenn ich nur zehn Minuten Zeit habe mit meinen Kindern, dann bespiele ich nicht gleichzeitig noch drei Handys nebenbei und vergeude damit die zehn Minuten; dann muss ich zehn Minuten ganz da sein. Wenn ich als Arzt nur fünfzehn Minuten für ein Gespräch habe, dann kann ich nicht ständig nur auf den Computer schauen und irgendwelche Befunde vorlesen und nicht ein einziges Mal Kontakt mit dem Patienten in der Berührung und im Sehkontakt haben.
Neben dem Kommunikationsdilemma gibt es auch noch ein Vertrauensproblem zwischen Arzt und Patient. Sie haben eine eigene Umfrage unter Frauen mit Eierstockkrebs oder Brustkrebs gemacht. Danach glauben etwa 30 Prozent der Befragten, dass der Arzt ihnen nicht die Wahrheit sagt.
Ja, das ist Wahnsinn, oder?
Aber Sie als Klinikchef haben ja die Möglichkeit, das in Ihrem Zuständigkeitsbereich zu ändern. Was tun Sie?
Erstens muss ich selbst ein gutes Vorbild sein. Zweitens gibt es bei uns das Leitbild, dass in der Klinik nicht gelogen wird. Ehrlichkeit muss aber natürlich auch dosiert sein, denn es gibt Menschen, die mir sagen, dass sie mit dieser Ehrlichkeit schwer klarkommen. Das muss man auf beiden Seiten aushalten. Aber das, was gesagt wird, muss wahr sein. Aber nicht alles, was wahr ist, muss auch gesagt werden. Wie viel Wahrheit ein Mensch dann will, muss er selbst entscheiden. Er kann auch sagen, dass er nichts wissen will. Das ist auch in Ordnung. Es gibt im Rahmen der Krankheitsverarbeitung aber häufig den Trend, etwas auszugrenzen oder sich etwas vorzuspielen. Es ist ganz leicht, da als Arzt mitzumachen, aber das bleibt an der Oberfläche.
Mir ist das Thema Wahrheit ganz wichtig. Ich sage ganz offen, dass ich die absolute Wahrheit nicht kenne, aber das, was ich weiß, will ich der Patientin mitteilen ohne emotionslos zu klingen, denn ich bin der Überzeugung, dass Wahrheit die Grundlage jeglicher ethischen Auseinandersetzung und jeglichen Kampfes sein muss. Denn wie soll ich auf Basis einer Lüge mitkämpfen?
Wie bereitet man sich konkret auf ein existentielles Gespräch vor? Sie haben eine Patientin, die zur Untersuchung kommt, und Sie müssen ihr sagen, der Krebs ist wieder da. Was tun Sie?
Ich nehme mir die Zeit. Das heißt, dass ich nicht aus dem OP direkt in das Gespräch renne. Wenn ich weiß, ich habe eine schlechte Nachricht zu überbringen, dann hole ich erst mal tief Luft (holt tief Luft) und dann versuche ich, die Situation zu verstehen: Was ist das für eine schlechte Nachricht? Welche Konsequenzen hat diese schlechte Nachricht für die Person, medizinisch und nicht-medizinisch? Kann ich mich die nächsten fünfzehn bis zwanzig Minuten komplett auf diese Patientin einlassen?
Ich muss nicht alle therapeutischen Konzepte durchgearbeitet haben. Wichtig ist es, frühzeitig einen Hinweis zu geben, dass eine schlechte Nachricht folgen wird, also eine Warnung abzugeben. Dann die Kernbotschaft mitteilen ohne sie zu relativieren oder zu beschönigen oder auf andere Themen zu springen. Und dann Pause! Meist wird den Patienten keine Pause gegönnt und sie sind dann nicht mehr aufnahmefähig. Der Arzt muss sich daran messen lassen, was beim Patienten tatsächlich und nachhaltig ankommt. Und man muss alle Emotion aushalten können und erlauben, natürlich nicht den Schlag ins Gesicht, aber schreien, weinen, Paralyse, Albernheit, Gegenfragen, das alles muss man erst mal erlauben, ohne es gleich zu bewerten. Manche Ärzte – auch das wieder ganz spiegelbildlich zur Gesellschaft – bewerten häufig zu früh. Sie entscheiden für die Patienten ohne die Patienten zu fragen. Am Ende des Gesprächs geht es um praktische und pragmatische Hilfsangebote und nächste mögliche Schritte, um den Menschen selbst wieder handlungsfähig zu machen.
Sie übernehmen aber nicht die ganze weitere Begleitung in dieser schwierigen Lebenssituation.
Nein, der Arzt muss nicht selbst am Krankenbett bleiben. Er kann delegieren, an den Seelsorger, an die Krankenschwester. Dazu muss er aber mit den anderen Berufsgruppen kommunizieren und Kernkompetenzen definieren. Die interprofessionelle Kommunikation mit Psychologen, Krankenschwestern usw. im Rahmen der Verarbeitung oder Begleitung der schlechten Nachrichten ist so im Medizinsystem aber nicht abgebildet.
Von der Begleitung bei der Verarbeitung der schlechten Nachricht zur „Suche nach der guten Nachricht“. So heißt eine Kapitelüberschrift in Ihrem Buch. Wird das Überbringen guter Nachrichten noch weniger bewusst gestaltet als das Überbringen schlechter Nachrichten?
Als ich beschlossen habe, das Buch zu schreiben, ist mir aufgefallen, wie viel über die schlechten Nachrichten gesprochen wird und ich habe mich gefragt, was mit den guten Nachrichten geschieht? Daraufhin habe ich einen Monat lang Tagebuch geführt und darin schriftlich festgehalten, wie viele gute Nachrichten und wie viele schlechte ich an einem Tag überbringe. Jeden Tag und nach jedem Gespräch habe ich mich gefragt: plus oder minus? Das Ergebnis war interessant. Etwa 80-90 Prozent der Interaktion, die ich mit Patienten hatte, waren eher mit einer guten Information behaftet, die aber in der Rückschau mir nicht präsent war. Daraufhin habe ich bewusst beschlossen, die Regeln für die Überbringung einer schlechten Nachricht auch für die Vermittlung der guten Nachricht anzuwenden. Erstens: Was ist die Kernbotschaft der guten Nachricht? Zweitens: Kündige ich die gute Nachricht auch so an, dass sie erkannt wird? Drittens: Pause.
Haben Sie ein konkretes Beispiel?
Ich gehe auf Station und sage einer Patientin: Die Operation, die wir gestern durchgeführt haben bei einem fortgeschrittenen Eierstockkrebs fast im Endstadium ist sieben Stunden erfolgreich durchgeführt worden. Und ich muss ihnen sagen, Hut ab, dass ihr Körper und ihre Seele diese schwere Operation überstanden haben. Pause! Viele Patientinnen fangen an dann zu weinen.
Die Selbstverständlichkeit der guten Nachricht droht durch die Ignoranz in unserer Gesellschaft, die sich leider auch in der Medizin durchgesetzt hat, unterzugehen. Wir brauchen einen Perspektivwechsel in der Medizin und unserer Gesellschaft. Sie gehen zur Blutabnahme zum Arzt und dann sagt er ihnen, was nicht normal ist. Er spricht aber nicht darüber, was alles in Ordnung ist. Er sagt maximal mal Sätze wie: Alles andere war gut. Was ist denn alles andere! Dass die Leber in Ordnung ist! Die Niere auch! Sag‘ das doch! Und formuliere: Schön, dass wir uns heute getroffen haben und nur über gute Ergebnisse gesprochen haben!
Sie zelebrieren die guten Befunde also regelrecht?
Wie groß muss eine gute Nachricht sein, damit wir sie beachten? Man muss die gute Nachricht suchen, um sich einen Puffer aufzubauen und auch, um die schlechte Nachricht besser zu erkennen. Aber ich habe das auch mal konkret nachgeprüft. Ich habe pro Tag etwa drei bis vier Gespräche mit schlechten Nachrichten und etwa 10 bis 20 gute Gespräche.
Sich das bewusst zu machen, ist auch eine Ihrer persönlichen Kraftquellen?
Ja, das schützt einen selbst und stärkt die Resistenz als Arzt. Ich positioniere mich und sage, das ist der wunderbarste Beruf und die schlechten Nachrichten sind aber Teil davon. Und viele der schlechten Nachrichten sind trotzdem auch gut, denn es geht um gute Beziehungen. So kann man es formulieren: Ich trenne mich von der Nachricht und definiere mich überwiegend über die Beziehung zu meinen Patienten und ihren Angehörigen. Es ist nicht so, dass alle Gespräche unproblematisch sind, aber grundsätzlich gibt mir diese Beziehungsebene die Kraft.
Am Ende des Tages geht es immer um die Beziehung mit sich selbst und dem Anderen. Wenn sie sich der Stärke der Beziehungen bewusst sind und an dem Thema Beziehung arbeiten, können auch ungeschickte Worte verziehen werden. Aber man darf sich nie einfach so vorbeimogeln.
Wie sieht das nach dem langen Tag in der Klinik aus? Nehmen Sie Themen mit nachhause?
Ich habe ja wirklich eine sehr tiefe Beziehung zu meinen Patienten. Sehr tief. Trotzdem habe ich für mich entschieden, dass ich Arzt sein will und dass ich Profi bin. Profi bedeutet, ich kann nicht immer mit sterben. Ich versuche immer, mein Bestes zu geben. Das gelingt mir nicht immer, aber ein Tod oder eine Komplikation ist für mich grundsätzlich keine Infragestellung meiner Person und meines Berufes. Es trifft mich. Ich schlafe dann manchmal auch schlecht. Aber ich sterbe nicht. Ich stelle meine Entscheidung, Arzt zu werden, nicht existentiell infrage. Ich sehe mich auch in der Verantwortung, für alle meine Patienten da zu sein.
Haben Sie ein Ritual, wie Sie abends abschalten?
Ich gehe jeden Abend auf dem Nachhauseweg einkaufen, kaufe Joghurt und so weiter. Ich deeskaliere über meinen Einkauf im Supermarkt. Jeden Tag. 22.00 Uhr macht der Supermarkt bei mir zu und so muss ich zusehen, dass ich es vor 22.00 Uhr schaffe, sonst habe ich ein Problem. Dann gehe ich hoch in die Wohnung, begrüße meine wunderbare Frau, die Kinder schlafen meistens schon, dann räume ich den Einkauf ein. Einkaufen und Abendessen in der Familie ist mein Ritual zur Deeskalation. Das ist mein Weg, jeder macht es anders.
Besonders viel über Ihren persönlichen Weg erfährt man in Ihren beiden belletristischen Büchern. „Marrakesch“ bezeichnen Sie als Selbstfindungsbuch und in dem Buch „Und von Tanger fahren die Boote nach irgendwo“ kommen Sie Ihren marokkanischen Wurzeln sehr nahe. Ihre Eltern kommen aus Tanger. Das Buch ist eine Liebeserklärung an Ihre Mutter.
Ja, ich kann Ihnen das nur beschreiben, denn Sie sind ja jetzt nicht hier in meinem Büro, aber in meinem Zimmer, in meinem Schreibtisch, habe ich ein Foto meiner Mutter. Das ist für mich ganz wichtig. Meine Mutter hat mich geprägt, mich geformt. Meine Mutter liebte die Medizin, sie selbst war Analphabetin, sprach aber fünf Sprachen und war so stolz, als Stationshilfe im Weddinger Krankenhaus zu arbeiten. Und obwohl einige meiner Lehrer mir immer wieder klarmachen wollten, dass ich nicht gut genug für ein Medizinstudium sei, verfolgte ich meinen Wunsch, unterstützt von meiner wunderbaren Mutter, hartnäckig – und wie man sieht, mit Erfolg.
Ich muss Ihnen dazu noch etwas zeigen (steht auf und nimmt ein Bild von der Wand, kommt zurück zum Telefon). Das ist eines meiner Schulzeugnisse, und zwar datiert vom 30. Januar 1981; das hängt in einem großen Bilderrahmen hier in meinem Büro an der Wand. Ich lese Ihnen das mal vor. Allgemeine Beurteilung/Verhalten in der Schule: im Ganzen gut. Mitarbeit im Unterricht: befriedigend. Deutsch: mündlich: vier schriftlich: vier. Geschichte: vier. Sozialkunde: drei. Erdkunde: drei. Englisch fünf: mündlich: vier, schriftlich: fünf: Latein: fünf Mathematik: vier. Physik: drei. Biologie: zwei. Musik: drei. Bildende Kunst: fünf Leibesübungen: zwei. Bemerkung: Khalid – mein Name sogar falsch geschrieben! – verlässt das Gymnasium, um auf eine Realschule überzugehen.
Das spricht Bände: Ich war auf dem Gymnasium, habe aber das Probejahr nicht bestanden und bin dann auf die Realschule gekommen. In der zehnten Klasse wechselte ich wieder auf ein sogenanntes Aufbaugymnasium, alles hier im Wedding, im Arbeiterbezirk Berlins. Ich will damit nur eines zeigen: Sie können trotz Deutschnote mündlich fünf in der 7. Klasse Bücher schreiben und trotz einer fünf in Latein Direktor einer Klinik sein! Deutschland ist wunderbar.
Das spornt an! Ihre Mutter war Analphabetin. Sie beherrschte aber mehrere Sprachen und viele andere Dinge aus unterschiedlichen Kulturen. Sie schreiben mit großer Bewunderung über die innovative Kraft Ihrer Mutter. Und Sie sind jetzt das Idealbild einer gelungenen Integration.
Wobei ich das gar nicht so sehe, ich möchte damit nur zeigen, dass wirklich vieles möglich ist. Mir haben meine Lehrer immer gesagt, dass ich nie Arzt werden könnte, weil ich in Mathematik und Physik so schlecht sei. Wenn mich heute ein junger Mensch fragt, was er können muss, um Arzt zu werden, dann sage ich: Wenn man Arzt werden will, dann muss man einfach die Menschen lieben – und natürlich auch die Fähigkeit haben, es nicht als Niederlage zu empfingen, wenn etwas nicht gut läuft. Aber ich denke nicht, dass perfekte Latein- oder Deutschkennnisse entscheidend dafür sind. Natürlich ist Sprache wichtig, aber hier geht es nicht um Grammatik, sondern um Kommunikation. Den Genitiv habe ich bis heute nicht verstanden.
Und zum Thema Integration. Wissen Sie, es geht nicht allein um Sprachkurse. Es geht um Haltung. Es geht darum, sich mit dem, was man kann, einzubringen. Meine Mutter war Analphabetin, sie war auditiv sozialisiert, sie konnte mehrere Sprachen, sie hörte ein spanisches Wort und konnte das! Sie müssen auditive Sprachkurse machen, nicht so viel Grammatik. Ich würde heute wieder eine fünf in Deutsch kriegen, wenn sie mir mit Grammatik kommen. Ich kann Sprache über die Melodie lernen …
… und offensichtlich auch durch Gedichte, denn davon gibt es viele in Ihren Büchern. Nochmal zum Thema Integration: Sie selbst bezeichnen das Fußballtraining als einen Wendepunkt in Ihrem damaligen jugendlichen Leben in Berlin-Wedding. Sie haben sich damals dem Fußball als Jugendlicher mit großem Einsatz und Ehrgeiz gewidmet und dabei viel gelernt.
Ja, man wird ausgewechselt oder gar nicht erst aufgestellt, man erlebt Kränkungen – das zu erfahren und trotzdem auf dem Weg zu bleiben, ist eine sehr gute Schule.
Sie würden Kinder aus Flüchtlingsfamilien zunächst Fußball spielen oder etwas anderes tun lassen, das sie bereits können. Sie haben geschrieben, dass wir Deutsche Menschen oft zu sehr über Defizite definieren.
Genau, aber das ist das System. Das ist in der Medizin auch so. Was ist anders? Was ist nicht normal? Wo fehlt es? Nein, es geht zuerst um Selbstbewusstsein und Dialogfähigkeit. Und das ist nur möglich über ein Gefühl der Vertrautheit. Dann kommt Kommunikation zustande. Und nicht, indem man damit beginnt, was alles schlecht ist, was nicht geht und woran man gescheitert ist. Integration bedeutet für mich eher zu fragen, was habe ich an Stärken, was habe ich an Schwächen, und wie kann ich die Stärken zum Wohle der Allgemeinheit und meiner eigenen Person fortführen und ergänzen.
In Ihrem Marrakesch-Buch habe ich gelesen, dass Sie einen Vortrag gehalten haben über die Frage: „Was hat ein Geschichtenerzähler aus Marrakesch mit einem Universitätsprofessor in Berlin gemeinsam?“
Ja, das stimmt. Das ist ähnlich wie mit dem Essen: Streuselschnecke und Couscous. Es ist kein Widerspruch, wenn sie verschiedene Eigenschaften oder Vorlieben in sich tragen, sie müssen sich nicht entscheiden, sondern sie können das ganze Paket behalten. Warum soll ich mir denn nicht der Kraft des Geschichtenerzählens bewusst sein und das in meinen ärztlichen Beruf einfließen lassen ohne aber meine Kernkompetenz zu verlassen. Und genauso muss ich mich keinem Konflikt aussetzen und mich für Streuselschnecke oder Couscous entscheiden. Ich frühstücke Streuselschnecke und abends esse ich Couscous.
Dazu passt auch die Diskussion um narrative Medizin, dieses neue Wort, über das wir seit drei, vier Jahren sprechen. Das sind eigentlich die Ursprünge der medizinischen Heilkunst. Der Märchenerzähler oder der spirituelle Heiler geht eine Verbindung ein mit der analytisch naturwissenschaftlichen Medizin, ohne dass das ein Widerspruch ist. Dazu muss man sich aber erst mal bekennen. Warum konnte damals jemand Schriftsteller, Arzt und Astrophysiker sein und heute sind wir als Mediziner nur trockene Analytiker. Als ich mir dieser Kraft des Geschichtenerzählers bewusst wurde, sind meine medizinischen Vorträge noch besser geworden. Es gibt auch Menschen, die sagen, dass mein Schreiben nichts mit meinem Beruf zu tun hat. Ich denke, dass meine Schriftstellerei mich zu einem besseren Arzt macht.
Herr Sehouli, ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
Vita: Prof. Dr. med. Jalid Sehouli
Jalid Sehouli (Jahrgang 1968) ist Kind marokkanischer Eltern. Diese kamen in den 1960er Jahren aus Marokko nach Deutschland. Sehouli wuchs mit drei Geschwistern im Berliner Arbeiterbezirk Wedding auf. Nachdem er zunächst eine Ausbildung zum Krankenpfleger begonnen hatte, erhielt er über das Auswahlverfahren einen Studienplatz für Humanmedizin an der Freie Universität Berlin, wo er von 1989 bis 1995 studierte.
1998 promovierte er mit einer Dissertation zur postoperativen Nutzung unkonventioneller Krebstherapien in der gynäkologischen Onkologie. 2002 wurde er Facharzt für Frauenheilkunde und Geburtshilfe. Im Jahr 2005 schloss er seine Habilitation an der Humboldt-Universität zu Berlin zum Thema „Multimodales Management maligner Ovarialtumore“ ab.
2005 erhielt er die Lehrbefugnis für Gynäkologie und Geburtshilfe und nahm 2007 den Ruf auf die W2-Professur für Gynäkologie an der Charité an. 2014 folgte er dem Ruf auf die W3-Professur für Gynäkologie auf Lebenszeit.
Prof. Dr. Jalid Sehouli ist seitdem Direktor der Klinik für Gynäkologie mit Zentrum für onkologische Chirurgie am Campus Virchow-Klinikum der Charité und Leiter des Gynäkologischen Tumorzentrums und Europäischen Kompetenzzentrums für Eierstockkrebs. Er gehört zum Kreis der weltweit führenden Krebsspezialisten. Die Charité-Universitätsmedizin Berlin ist die gemeinsame medizinische Fakultät von Freier Universität Berlin und Humboldt-Universität zu Berlin und zählt zu den größten Universitätskliniken Europas.
2015 erhielt er den Roma Focus Award für seine Verdienste in der Krebsmedizin für die Frau, 2016 verlieh ihm der marokkanische König Mohammed VI den Diwan 2017, einen Orden für seine wissenschaftlichen Leistungen in Deutschland.
Sein erstes belletristisches Buch "Marrakesch" erschien 2012 und wurde 2018 neu aufgelegt.
In seinem zweiten Werk "Und von Tanger fahren die Boote nach irgendwo" (2016) machte er Tanger, die Heimatstadt seiner Eltern zum Ausgangspunkt philosophischer und autobiographischer Betrachtungen.
2018 erschien das Sachbuch "Von der Kunst, schlechte Nachrichten gut zu überbringen".
Sehouli ist mit Adak Pirmorady-Sehouli verheiratet und hat vier Kinder.
*Angelika Beyreuther führte das Gespräch mit Prof. Jalid Sehouli für die August-Ausgabe des Fachbuchjournals. Wir danken dem Fachbuchjournal für die freundliche Genehmigung zum Abdruck. © 10. Jahrgang, August 2018, Ausgabe 4, ISSN 1867-5328-15238
Veröffentlicht für Convivio mundi e.V.
Montag, 3. September 2018
"Wir brauchen einen Perspektivwechsel in der Medizin und unserer Gesellschaft"
Ein Gespräch mit Prof. Dr. med. Jalid Sehouli



