Über das Sterben reden
Dr. Henning Scherf schreibt Bücher über das Alter; es sind Bestseller: Grau ist bunt; Wer nach vorne schaut, bleibt länger jung; Altersreise; Gemeinsam statt einsam; Das letzte Tabu. Vor der Pandemie war er ständig unterwegs. Er meisterte bis zu zweihundert Lesungen und Vortragsveranstaltungen im Jahr, alle gut besucht. Die Themen brennen also vielen auf den Nägeln. In Das letzte Tabu setzt Henning Scherf sich gemeinsam mit der Wissenschaftlerin Annelie Keil mit Sterben und Abschied nehmen auseinander; ein durch die Corona-Pandemie in ganz besonderer Weise gegenwärtiges Thema. Genauso wie das Thema Sterbehilfe, das durch die Aufhebung des Verbots der geschäftsmäßigen Suizidhilfe durch das Bundesverfassungsgericht nun ein neues Gesetzgebungsverfahren zu deren Regelung notwendig macht. Wir baten Dr. Henning Scherf zu diesen Themen um seine Meinung. (ab)*

Dr. Henning Scherf
(Foto:© Senatskanzlei | Anja Raschdorf)
Medizinstatistiken zeigen, dass in unserer Gesellschaft seltener plötzlich und unerwartet gestorben wird, sondern meist langsam und vorhersehbar in betagtem Alter außerhalb des vertrauten häuslichen, familiären Umfelds auf Intensiv- und Palliativstationen von Kliniken, in Pflegeheimen oder Hospiz-Einrichtungen. Das hat zur Einsamkeit und Isolation der Menschen am Lebensende geführt. Sie möchten das Thema Sterben wieder in die Mitte unserer Gesellschaft holen. Wie stellen Sie sich das vor?
Wir haben in unseren gemeinsamen 33 Jahren als Hausgemeinschaft drei Sterbefälle in unserem Haus erlebt. Bei der mit uns gleichaltrigen Mutter ging eine zweijährige Pflegezeit voraus, in der wir mit ambulanter ärztlicher Unterstützung alles an Pflege selber bewältigt haben. Danach war ihr ältester Sohn, der auch bei uns im Mehrgenerationenhaus wohnte, fast fünf Jahre ein Pflegefall, ebenfalls in unserer Mitte. Beide sind in ihrer vertrauten Umgebung gestorben. Der letzte Sterbefall ereignete sich am Heiligen Abend vor einigen Jahren. Nach einem gemeinsamen Essen und Trinken mit Freunden fiel unser Priesterfreund durch eine Gehirnblutung ins Koma und starb zwei Wochen später.
Sie nennen das eine „Kultur der Menschlichkeit am Lebensende“.
Zu viele Menschen überlassen ihre sterbenden Verwandten und Freunde den professionellen Dienstleistern. Sie resignieren vor der Aufgabe, selber präsent zu sein. Wer sich für sein eigenes Sterben wünscht, von Freunden und Familie umringt zu sein, der sollte dies selber vorher gelebt haben. Es ist für alle eine große Erfahrung, wenn es gelingt, das Sterben in die Mitte des Lebens zu integrieren.
Sie wollen auch, so schreiben Sie in Das letzte Tabu, „die Mutlosigkeit und die Sinnlosigkeit, die viele in unserem Kulturkreis mit dem Sterben verbinden, aufbrechen und sagen: Es gibt ein Leben im Sterben und es gibt ein Sterben im Leben“. Das würde ich gerne besser verstehen.
Noch immer stirbt die Mehrheit zu Hause. Das ist auch der Wunsch der großen Mehrheit. Damit das auch zukünftig möglich ist, muss die ambulante Versorgung ausgebaut werden. Dazu gehören auch Gemeindesozialarbeiter, die wissen, wo Menschen einsam und hilflos leben und die dann über vernetzte ambulante Hilfestrukturen helfen können.
Immer mehr stationäre Betten zu fordern, ist angesichts des Pflegenotstands kein zukunftsträchtiges Konzept. Wir müssen als Gesellschaft näher zusammenrücken. Unser Beispiel einer Hausgemeinschaft ist eine erreichbare Alternative.
Die Phantasie von Unsterblichkeit ist der trostlose Versuch, der Endlichkeit eines jeden von uns auszuweichen. Dabei ist gerade das Nachdenken über „Stirb und werde“ das Zentrum unseres humanen Lebens. Wir unterscheiden uns von den Tieren dadurch, dass wir unsere Endlichkeit reflektieren können. Und wenn das gelingt, ist jeder Tag ein Geschenk.
Deshalb sind Sie auch gegen geschäftsmäßige Sterbehilfe? Ihnen graut vor diesem „suspekten Geschäft“, schreiben Sie. Haben Sie Erfahrungen mit dieser Szene gemacht?
Ja, immer wieder. Der frühere Hamburger Justizsenator und bekannteste Sterbehelfer war mehrere Jahre mein Kollege. Seine Arbeit und sein politisches Scheitern habe ich über Jahre erlebt.
Und in einer „Anne Will“-Sendung habe ich mit dem Geschäftsführer des schweizerischen Sterbehilfe-Unternehmens diskutiert. In dieser Live-Sendung meldete sich aus dem Publikum eine ehemalige Mitarbeiterin und erzählte, wie sie den Sterbehilfesuchenden, die je näher der Termin rückte, desto unsicherer wurden, aus Geschäftsgründen weiterhin zugeredet haben. Etwas Ähnliches habe ich bei „Hart aber fair“ erlebt, allerdings in entgegengesetzter Weise. Da wütete ein Franziskaner Mönch gegen einen anwesenden Ehemann einer mit ärztlicher Sterbehilfe verstorbenen Ehefrau.
Und schließlich habe ich erlebt, wie Freunde, die ähnlich wie Walter Jens sich ein selbstbestimmtes Sterben in Zeiten ihres Wohlbefindens gewünscht hatten, dann davor zurückgeschreckt sind, als das Sterben immer näher rückte.
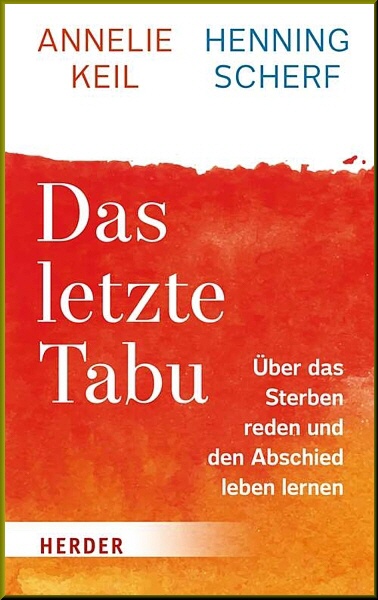
Nun zeigen Umfragen in Deutschland, dass ein hoher Prozentsatz der Ärzteschaft ebenso wie der Bevölkerung die Möglichkeit einer assistierten Suizidhilfe befürworten. Sehen Sie darin einen unauflöslichen Widerspruch?
Nach meiner Wahrnehmung ist das Gegenteil richtig: die große Mehrheit der Ärzte wehrt sich gegen Sterbehilfe, und Sterbehilfevereine erreichen nur eine winzige Gruppe.
Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts hat nicht nur die Politik, sondern auch die bisher an der Debatte Beteiligten überrascht. Die gegenwärtige Rechtsunsicherheit erfordert eine gesetzliche Klärung. Und die wird wie bei den vorangegangenen Beratungen nicht mit Fraktionszwang beendet, sondern quer durch die Parteien mit Gewissensentscheidungen der Beteiligten getroffen werden müssen.
Ihre Wahrnehmung wird durch die Deutsche Gesellschaft der Palliativmediziner gestützt die erklärt, dass es den Todeswunsch Sterbender gar nicht gibt. Lediglich in Einzelfällen fragten Menschen in ihrer Sterbephase nach einem assistierten Suizid. Sie vermuten, wie bei Walter Jens und einigen Ihrer Freunde, dass die Forderung nach Sterbehilfe bei den meisten ein Konstrukt guter Tage sei. Was folgt daraus?
Die Palliativmedizin ist die alles entscheidende Hilfe. Die noch zu findende gesetzliche Klärung muss deren Arbeit aufwerten und vor Bedrohungen schützen.
Am 22.04.2021 begann die erste beratende Bundestagsdebatte zu neuen Regeln der Sterbehilfe, nachdem das Bundesverfassungsgericht den vom Bundestag 2015 beschlossenen Strafrechtsparagrafen 217, das „Gesetz über die Strafbarkeit der geschäftsmäßigen Förderung der Selbsttötung“, am 26.02.2020 für nichtig erklärt hatte. Der Leitgedanke des Grundsatzurteils: Das allgemeine Persönlichkeitsrecht als Ausdruck persönlicher Autonomie umfasst auch ein Recht auf selbstbestimmtes Sterben. Was raten Sie der Politik?
Ich rate, die Erfahrungen anderer Länder zu berücksichtigen. So wird immer wieder auf den US-Staat Oregon verwiesen. Für den dort erlaubten medizinisch assistierten Suizid muss ein Mensch an einer unheilbaren Krankheit leiden, die nach Auffassung von zwei Ärzten wahrscheinlich in sechs Monaten zum Tode führt. Vor allem Ärzte sollten über den assistierten Suizid wachen.
Welchen Raum sehen Sie in den Grenzbereichen menschlichen Lebens und Sterbens für individuell verantwortetes Handeln im Vertrauensverhältnis zwischen Ärztin und Patient? Hat das Strafrecht da einen Platz?
Das Strafrecht muss sich in dieser existenziellen Grenzfrage sehr zurückhalten. Ich beobachte seit Langem, dass die deutsche Justizpraxis mit ganz wenigen Ausnahmen diesen Aspekt praktiziert. Es muss alles getan werden, um das Vertrauensverhältnis zwischen Ärzten und Patienten zu schützen.
Und persönlich: Sie haben sich sicher konkrete Gedanken dazu gemacht, wie Sie Ihren allerletzten Lebensabschnitt erleben möchten.
Das beschäftigt mich seit Langem. Ich möchte umgeben von Familie und Freunden sterben können. Ich möchte da sterben, wo ich zu Hause bin. Mit meiner Patientenverfügung habe ich eine lebensverlängernde Apparatemedizin ausgeschlossen. Ich wünsche mir einen verständigen Palliativmediziner an meiner Seite, der in Gesprächen mit mir geklärt hat, was mein Sterbewunsch ist
Vita: Dr. Henning Scherf
Dr. Henning Scherf, geb. 1938, war lange Jahre Sozial-, Bildungs- und Justizsenator und von 1995 bis 2005 Präsident des Senats und Bürgermeister der Freien Hansestadt Bremen. Er ist verheiratet, hat drei Kinder, ist neunfacher Großvater und lebt seit vielen Jahren in einer Haus- und Wohngemeinschaft.
*Wir danken dem Fachbuchjournal für die freundliche Genehmigung zum Abdruck.
© 13. Jahrgang, Ausgabe 3/2021, ISSN 1867-5328
Über das Sterben reden
"Wir müssen als Gesellschaft näher zusammenrücken"
Dr. Henning Scherf im Gespräch

